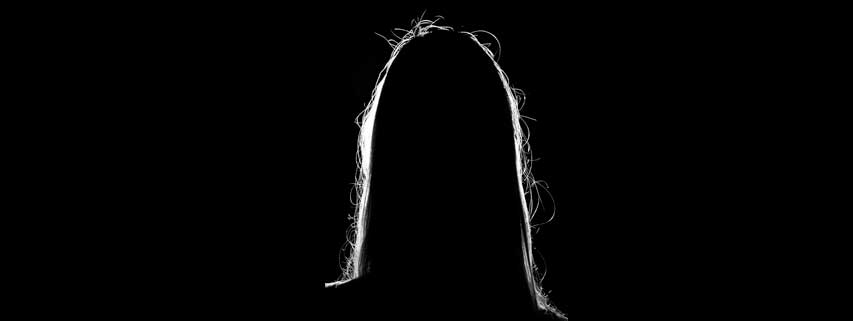Gedanken zum Thema Sportswashing und die Frage: 1:59:40 und was jetzt?
Zweifellos hat Eliud Kipchoge mit der Zeit von 1:59:40 über die Marathondistanz von 42,195 Kilometer in Wien Geschichte geschrieben. Um so eine Leistung zu bringen, müssen neben Laborbedingungen auch jahrelanges Training, soziale Unterstützung und ein unbändiger Wille zum Sieg vorhanden sein. Seine Aussage „er wollte zeigen, dass kein Mensch limitiert ist“, ist in Anbetracht der Entwicklung von Hochleistungssport zumindest hinterfragenswert.
Ich laufe, um Geschichte zu schreiben und zu zeigen, dass kein Mensch limitiert ist.
Eliud Kipchoge
Modellzeit
Der US-Mediziner Mike Joyner hatte 1991 berechnet, dass ein Marathon unter zwei Stunden möglich ist. 01:57:58 wären demnach theoretisch das Schnellste, was ein idealer Mensch unter idealen Bedingungen – Laborbedingungen – laufen könnte. Dieses errechnete Limit zu unterbieten, scheitert vor allem am Limit der maximalen Sauerstoffaufnahme, auch die Laktat-Schwelle und Laufökonomie führt Joyner als physiologische Bedingungsfaktoren an.
[av_font_icon icon=’ue835′ font=’entypo-fontello‘ style=“ caption=“ link=’manually,https://pdfs.semanticscholar.org/6699/5d7becac8e72576c6e9a828a6315982c16b7.pdf‘ linktarget=“ size=’14px‘ position=’left‘ color=“ admin_preview_bg=“][/av_font_icon] Modeling: optimal marathon performance on the basis of physiological factors – PDF
VO2max
Die für Ausdauersportarten so wichtige maximale Sauerstoffaufnahme ist den meisten Studien zufolge zu rund 50 Prozent genetisch festgelegt. Die Körpergröße liegt zu bis zu 80 Prozent, der Body-Mass-Index zu 30 bis 50, die Muskelkraft und die maximale Sauerstoffaufnahme zu rund 50 Prozent in den Genen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg ist damit offenkundig: den zur Sportart passenden Körperbau zu haben.
Kalendjin – ein Langstreckenvolk
Die meisten Langstreckenläufer aus Kenia sind Kalendjin, auch Eliud Kipchoge. Sie machen gerade 0,06 Prozent der Weltbevölkerung aus, haben aber rund 60 olympische Medaillen auf der Mittel- und Langstrecke gewonnen und stellen drei Viertel der kenianischen Spitzenathleten. Forscher der Universität Kopenhagen haben mehrfach Kalenjin-Läufer mit gleichaltrigen dänischen Jungen verglichen. Sie stellten Vorteile im Körperbau der Afrikaner fest, nicht jedoch gravierend bessere Anlagen für die maximale Aufnahmefähigkeit von Sauerstoff.
Evolution und Anpassung
Was im Laufe der Evolution eine Anpassung an das Klima und die Umgebung war, nutzt auch der Biomechanik beim Langstreckenlauf: Über Jahrhunderte mussten die Kalenjin ihrem Vieh hinterherrennen. Die Gene der besten Läufer hätten sich letztlich durchgesetzt, meint David Epstein, Autor des Buches „The Sports Gene“. Doch seit einigen Jahren fällt ein Schatten über Kenias Laufszene. Athleten mit großen Namen wurden beim Dopen erwischt und gesperrt. Kenia hat ein ernsthaftes Doping-Problem.
Talent und Gene
Bis heute wurden weit mehr als 200 Genvarianten identifiziert, die mit der sportlichen Leistung zusammenhängen. Manche Sportverbände setzen heute schon mehr oder weniger offiziell Gentests ein, um Talente zu finden: in Usbekistan, angeblich auch in China und Mexiko.
Sport ohne Limits?
„Ich laufe, um Geschichte zu schreiben und zu zeigen, dass kein Mensch limitiert ist.“, letzteres an der Aussage Kipchoges irritiert mich. Klar, um so eine Leistung zu bringen müssen jahrelanges Training, soziale Unterstützung und der Wille zum Sieg vorhanden sein. Weltklasseleistungen sind neben körperlichen Voraussetzungen immer auch erarbeitet, erkämpft. Aber zu viele Athlet*innen überwinden die eigenen Grenzen mit Doping. Und auch Gendoping ist längst keine Utopie mehr.
Gendoping
Wenn man von Gendoping hört, wird meist von Gendoping im engeren Sinn gesprochen – den Missbrauch gentherapeutischer Maßnahmen, das konkrete Zuführen von genetischem Material, zum Beispiel DNA oder RNA. Gendoping im weiteren Sinn zielt auf die Manipulation der Genexpression mittels hochspezifischer Medikamente – etwa Steroiden.
Doping als Resultat sozialer Faktoren
Das Doping-Problem, mit dem die kenianische Läuferszene ringt, hat soziale Ursachen. Viele Athleten kommen aus sehr bescheidenen Verhältnissen auf dem Land und werden direkt in den Leistungssport katapultiert. Ich denke mit Grauen an die Dopingszene in der DDR – auch sie basierte auf Abhängigkeit, gekennzeichnet von Menschenverachtung und Machtmissbrauch. Wenn der Durchbruch, der zwei Stunden-Marathongrenze als Durchbruch einer psychologischen Barriere des Laufsports frenetisch gefeiert wird, tut sich noch eine andere Sichtweise auf.
Cui bono?
Wer profitiert letztendlich am meisten von Höchstleistungen? Nicht der Sport im allgemeinen, gesellschaftlichen Sinn, schon gar nicht die Athlet*innen. Für die Freude am Laufen in ihrer intrinsischen Motivation und den gesundheitlichen Wert von Bewegung, hat diese Bestzeit keine Auswirkung. Auch Leistungssport zählt nicht zu den Profiteuren. Athlet*innen werden immer austauschbarer und nur mehr an Ausnahmeleistungen gemessen. Und eines ist gewiss, bei 1:59:40 wird es nicht bleiben, wenn die Möglichkeit von 1:57:58 bereits prognostiziert ist.
1:59:40 und was jetzt?
Mike Joyner wollte bereits in den 1990ern seine These vom physischen Geschwindigkeits-Limit des Marathons untersuchen. Es fehlten ihm die Mittel. Dafür waren Sponsoren bereit, tief in die Tasche zu greifen. Wie unter anderem das Oregon Projekt zeigt, um auch unlautere Mittel & Massnahmen zu finanzieren. Dort wo sehr viel Geld im Spiel ist, geht es längst nicht mehr nur um Marken-Kommunikation. Es geht um Sportswashing, mit dem das angekratzte Image von Unternehmen, ja sogar Staaten reingewaschen werden soll.
Sportswashing, alle machen mit
Es sind nicht nur Unternehmen und Staaten die Menschenrechte mit Füssen treten, die Interesse haben ihr Image im Umfeld des Sports strahlen zu lassen. Auch die Sportverbände, vom IOC abwärts, spielen munter mit. Denn spätestens seit Eliud Kipchoge die Schallmauer des Marathons durchrannt hat, ist klar, dass auch der Sport durch Sportswashing seine Reinheit zeigen soll. Genau das halte ich für groben Machtmissbrauch an Hochleistungssportler*innen, die sich meistens nicht bewußt sind, wofür sie eigentlich benutzt werden.
Links zum Thema
Der Wiener Heurige hat nun einen asketischen Kollegen – Joskos Blog, 12.10.2019
Rund 50 Prozent nutzen EPO – Kurzfassung der ZDF Reportage über Doping in Kenia, 31.05.2019
Geborene Sieger – Genetik im Sport, Zeit Online, 19. August 2016
Weltrekordler Eliud Kipchoge: Er wollte eigentlich im Büro arbeiten, SZ, 16. September 2018
Skandalmarathon in Katar bei 32,7 Grad: „Es war schrecklich“, Der Standard, 28. September 2019
Sportswashing and the tangled web of Europe’s biggest clubs, The Guardian, 15. Februar 2019